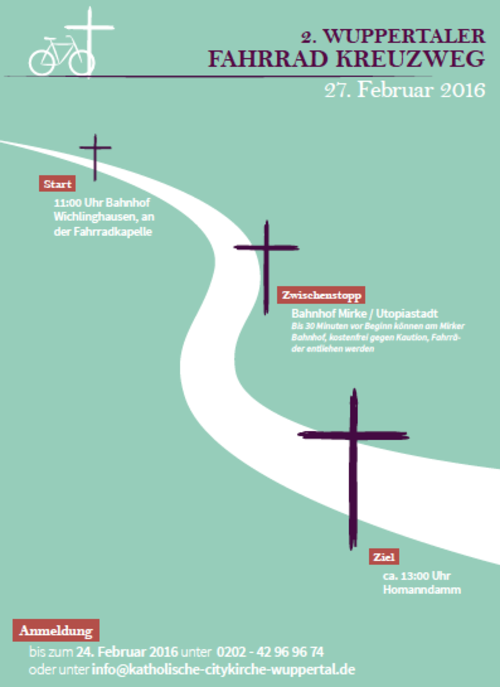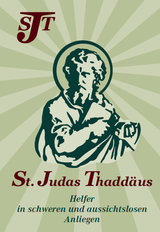Einen Link zur Abmeldung des Newsletters finden Sie am Ende dieser Mail.

Das Wort zur Woche (21. Februar 2016 - 2. Fastensonntag, Lesejahr C)
Liebe Leserinnen und Leser, Menschenfischer sind keine Architekten. Das Streben nach stabilen Verhältnissen ist menschlich verständlich, erweist sich faktisch aber als Illusion. Alles Planen und Bilden von Theorien bleibt schöner Schein wenn die Wirklichkeit des Lebens nicht in Rechnung gestellt wird. Auch das theologische System der Kirche ist ein fein austariertes Gerüst, das vor allem durch die feine Firnis theologischer Axiome zusammengehalten wird, deren Hinterfragung auf Allgemeingültigkeit in sich schon unter dem Verdacht defätistischer Destabilisierung steht. Jede pastorale Planungsstrategie, jeder sitzungsreich beschworene Aufbruch, jeder Leitbildprozess und jede ekklesiale Zukunftskonferenz der letzten Jahre und Jahrzehnte stand unter dem Signum, dass sich innerkirchlich letztlich nichts ändern wird. Auch im mit wohlwollender Aufmerksamkeit aufgenommenen Fastenhirtenbrief des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelki aus dem Jahr 2016 findet sich dieses Dilemma: Es wird viel von der Verantwortung der Getauften und Gefirmten geredet, die man jetzt eben nicht mehr missverständlich als „Laien“ bezeichnet, weil es unter den Getauften und Gefirmten eben auch eine stattliche Anzahl hochqualifizierter Profis gibt; es wird auch – seit den 1970er Jahren zum wiederholten Mal – das Paradigma beschworen, dass man endlich von einer versorgten zu einer mitsorgenden Kirche werden muss. Das alles klingt nach Aufbruch und viele wittern nicht zu Unrecht Morgenluft. Doch dann wird bei allem Streben nach Dezentralisierung der Aufbruch doch wieder an die alte Kette des hierarchischen Priestertums genommen:
Dass es Dienste und Ämter braucht, daran besteht kein Zweifel. Allerdings muss die Frage gestellt werden, ob „Hierarchie“ in der Kirche wirklich und faktisch im Sinne Kardinal Woelkis verstanden wird, der den Abschnitt über das Verhältnis des gemeinsamen Priestertums aller Getauften und dem Priestertum des Dienstes mit dem Satz abschließt:
Das ist die theologische Theorie. Faktisch aber steht die immer noch gedachte ontologische Superiorität der Geweihten dieser grundlegenden Gleichheit ebenso im Weg wie der Auftrag, dass das Priestertum der Weihe exklusiv der Konstituierung der Kirche Jesu vor Ort dient, der gelebten Gleichheit im Weg. Kirche erscheint so als Ort, wo ein Priester ist. Das ist kirchenrechtlich bewehrt, theologisch ummauert, ontologisch definiert. Letztlich sind alle Pastoralpläne darauf ausgerichtet. Und jeder Aufbruch schleppt diese sacerdotische Eisenkugel mit sich herum. Wie wenig wegweisend für einen echten Aufbruch das ist, zeigt in diesen Tagen die Reaktion des Münsteraner Pfarrers Thomas Frings, der seinen Rückzug aus der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Münster angekündigt hat und sich in ein niederländisches Kloster zurückzieht. In einem Facebook-Post vom 14. Februar 2016 schreibt er:
Thomas Frings war 1. September 2015 mit seinem Team zu Gast bei der Katholischen Citykirche Wuppertal. Wir tauschten uns gegenseitig über unsere Projekte aus. Gemeinsam war das Anliegen, gerade die Menschen zu erreichen, die nur einen geringen oder keinen Kontakt mehr zur Kirche hatten. In der Methode aber wurden erhebliche Unterschiede deutlich. Während die Katholische Citykirche Wuppertal bewusst den Weg zu den Menschen sucht, sich unter die Menschen mischt, Stadt und Alltag als Ort der Verkündigung nutzt, suchte man in Heilige Kreuz in Münster mit immer neuen und zum Teil pfiffigen Aktionen die Menschen in den Kirchenraum zu bekommen. Da wurden die Kirchenbänke herausgeschafft, damit die Leute mit den eigenen Stühlen den Kirchenraum neu möblieren. Eine Playmobilkrippe tritt an die Stelle der traditionellen Krippe. Auch an anderen Orten versucht man diese Wege zu gehen. Kirchenwerden dann bunt beleuchtet, man lädt die Menschen ein, Nachttischlampen in die Kirchen zu einer Installation zusammen zu stellen oder man feiert Pyjama-Gottesdienste. Das alles ist Hipp und kommt fürchterlich modern daher. Und tatsächlich verirrt sich die eine oder der andere in die sakrisch-modernen Gemäuer. Freilich bleibt die Frage: Wofür? Was ist das Ziel? Reicht es schon, dass ein Mensch eine Kirche betritt? Ist das ein magischer Ort, der die Menschen in sich mystisch verstrahlt? Diese Fragen blieben in dem Gespräch mit Thomas Frings Anfang September 20165 offen. Der Anfangserfolg gab ihm Recht, denn die Menschen kamen. Die Frage nach der Nachhaltigkeit wurde mit Verweis auf Hochglanzbroschüren, die von den tollen Projekten Zeugnis ablegten, beantwortet. Die Pastoral war bunt, der graue Alltag war aber stärker. Ich hatte damals schon den Zweifel geäußert, ob eine solche Arbeit langfristig durchzuhalten ist, denn immer neue Ideen zu produzieren, die sich selbst auch noch potenzieren müssen, um bleibend interessant zu sein, das ist wie Stroh im Ofen zu verbrennen. Es raucht und knistert einmal gewaltig, dann aber bleibt nur Asche. Wer da bleibenden Erfolg erwartet, darf sich nicht wundern, wenn der Gewöhnungsfaktor sich als größer erweist. Ein Manko einer solchen immer noch allerorts anzutreffenden pastoralen Haltung ist der Kirchenraum selbst. Die Menschen sollen in die Kirche kommen. Der Aufbruch wird vom anderen gefordert; man selbst bleibt lieber sitzen. Eine sitzende Kirche aber hat mit dem pilgernden Gottesvolk, von dem alle reden, wenig gemein. Tatsächlich gebärden sich die Pastoralplaner von heute aber immer noch mehr als Architekten, die hier und da die toten Steine altgewordener Gemäuer ausbessern, als im Ozean des Alltags auf Fischfang zu gehen. Und so konfektioniert man den Heiligen Geist auf das Weiheamt, und die Geweihten wähnen sich im Glanz des Rufes Gottes, der sie zu etwas so Besonderem macht, dass die Menschen doch eigentlich zu ihnen pilgern müssten. Aber niemand kommt da. Das frustiert manchen mehr als ihn die selbst bepredigte Glaubensfreude erfüllt. Die Versuchung, sich hinzusetzen und zu warten ist groß und alt. Sie befällt schon die drei Jünger Jesu, die Zeuge einer außergewöhnlichen Offenbarung des göttlichen Glanzes in Jesus selbst wurden. Das Evangelium vom 2. Fastensonntag im Lesejahr C erzählt von dieser Verklärung Jesu und der Reaktion des Petrus, Johannes und Jakobus. Die drei scheinen permanent müde zu sein. Denn immer wenn es wichtig wird, schlafen sie. Im Garten Getsemane, wenn es um das Leben Jesu geht – sie schlafen. Und auch hier übermannt sie die Müdigkeit. Das Licht des göttlichen Glanzes aber weckt sie. Dieses überhell gleißende Licht durchdringt selbst die müdesten Lider. Und so sehen sie Jesus mit Mose und Elija reden. Was für ein Ereignis, möchte man meinen. Davon muss die Welt erfahren! Aber den dreien fällt nur eins ein:
Der Evangelist Lukas beweist wirklich Humor, wenn er lapidar darauf hinweist, dass Petrus nicht wusste, was er sagte. Der müde Apostel möchte am liebsten vor Ort bleiben und erst einmal ein paar Hütten bauen. Das Heilige soll auf Konfektionsgröße gebracht werden, gezähmt, ein Ort der verehrungswürdigen Erinnerung an Vergangenes soll entstehen. Tote Steine entlasten von lebendiger Verkündigung. Es lässt sich wohlig klagen, dass niemand mehr kommt. In solcher Art verletzter pastoraler Eitelkeit vergisst manch ein Klagender aber, dass er selbst ein Gesandter ist. Paulus hat solches im Sinn, wenn er sich gleichermaßen motivierend wie mahnend an die Philipper wendet:
Paulus ist ein ruheloser Verkünder gewesen, der sich für keinen Streit zu schade war. Die beiden kanonischen Korintherbriefe legen dafür ein ebenso beredtes Zeugnis ab wie für seine oft sensible Verletzbarkeit. Paulus war ein leidenschaftlicher Verkünder, der auch jetzt angesichts nicht näher benannter „Feinde“ unter Tränen spricht. Paulus ist ein Mann, der einer durchdachten Strategie folgt. Er hat ein Konzept der Verkündigung mit ausgefeilter Verwaltung und einem gediegenen Mitarbeiterstab. Seinen Briefen ist zu entnehmen, dass er selbst Akten führte – wahrscheinlich in seiner „Zentrale“ in Ephesus, von der aus er seine missionarische Arbeit im östlichen Mittelmeerraum betrieb. Paulus war Profi durch und durch. Auch als charistmatischer Verkünder muss man nüchtern planen. Wer sich hier treiben lässt, wird nur am nächsten Riff zerschellen. Paulus aber plante und schonte sich selbst nicht. Er war ein Läufer, kein Sesselverkünder. Er ist keiner, dessen Gott der Bauch war, das eigene Wohlergehen, der eigene Ruhm. Er handelt so, weil er weiß, dass die Heimat des Glaubenden der Himmel ist. Wer keine Heimat auf der Erde hat, hat keinen Ort, den er sein Eigen nennen kann. Er ist Nomade, unterwegs, unstet stets bereit, das Wort Gottes zu verkünden. Und so sucht Paulus die Orte auf, an denen sich die Menschen einfinden: Die Synagogen ebenso wie die Agora in Athen, die Häuser der jungen Gemeinden ebenso wie die Gemeinschaften, die auf gemeinsamen Wegstrecken entstehen. Das ist eine Pastoral in actu, die mit der Ekklesia in situ, wie sie heute immer noch stilprägend ist und in der Residenzpflicht des leitenden Pfarrers mit festem Wohnsitz und – der Kirchensteuer sei Dank – gesicherten Versorgungsbezügen ihren zeitgemäßen Ausdruck findet. Die Hütten sind gebaut, der Verkünder kann wieder schlafen gehen. Es ist ein traumloser Schlaf, den viele Verkünderinnen und Verkünder, geweihte und ungeweihte, heute träumen. Satt und müde warten sie auf den Aufbruch. Manch einer schreckt mit Sodbrennen auf und blickt in die Dunkelheit einer pastoralen Nacht, die ihn um den Schlaf bringt. Niemand kommt mehr. Es wäre Zeit, aufzustehen und zu den Menschen zu gehen. Aber die Nacht ist kalt und der Alltag grau. Angst befällt die zaghaften Auserwählten, die sich ihrer Berufung selbst versichernd unter die Decke verkriechen und auf die Veränderung warten, die sie selbst immer wieder beschwören. Es ist die Angst vor der Veränderung, die lähmt. Wäre es die Furcht vor der Größe Gottes, es gäbe kein Halten mehr. Die erste Lesung vom 2. Fastensonntag im Lesejahr C erzählt vom Stammvater Abram, der später Abraham heißen wird, der im Schlaf von dieser Gottesfurcht befallen wird. Gott hatte ihm wider jede Vernunft und Erfahrung trotz seines und seiner Frau Sarahs Alter eine zahlreiche Nachkommenschaft verheißen und ein Land, das ihm zu Eigen sein wird. Und Abram fragt, was ein vernünftiger Mann angesichts einer solchen Behauptung eben fragt:
Das Zeichen, das Abram erhalten soll, wird ihm im Schlaf gewährt. Die Erzählung ist verstörend:
Die Lesung lässt einige Verse aus. Sie beinhalten eine Rede Gottes, der im Schlaf, also wahrscheinlich im Traum, zu Abram spricht:
Das sind auf den ersten Blick keine guten Nachrichten. Wer sich auf das Wort Gottes einlässt, muss einiges auf sich nehmen. Von Fremdsein ist die Rede, von Sklavenschaft, von einer langen Zeit, fern der Heimat, die die Nachkommen Abrams auf sich nehmen müssen. Vier Generationen werden darüber vergehen. Die gegenwärtig Lebenden werden das Ziel also selbst nicht erreichen. Sie müssen aber losgehen, damit die Nachkommen ankommen werden. Wer hier nur an sich und seinen kleinen Erfolg denkt, wird das Große Ganze gefährden. Gott gewährt Abram im Traum ein weiteres Zeichen. In Form eines rauchenden Ofens und einer Fackel durchschreitet er die Gasse, die sich zwischen den zerteilten Opfertieren gebildet hat. Das ist ein archaisches Zeichen eines Bundesschlusses. Der Bund gilt auf Leben und Tod. Mehr noch: Er entscheidet zwischen Leben und Tod. Wer sich so verbündet, verbündet sich auf Gedeih und Verderb. Aber es ist nur Gott, der diese Gasse durchschreitet. Abram sieht es ja im Traum. Er erhält die Verheißung und Verpflichtung Gottes ohne eigene Vorleistung. Er wird die Erfüllung der Verheißung aber erst erleben, wenn er aufwacht und losgeht. Es wird noch eine Zeit dauern, bis Abram, der zu Abraham wird, wirklich aufbrechen wird. Erst in Genesis 22 wird er sich ganz auf Gott einlassen und seinen Sohn Isaak, den ihm von Gott Verheißenen zum Opfer führen. Wer sich auf die Weisung Gottes einlässt, sein Wort in der Welt zu verkünden, muss in eben diese Welt gehen. Er darf dort keinen Applaus erwarten. Er darf auch nicht erwarten, dass die Welt in Scharen folgen wird. Die Saat wird oft erst Generationen später aufgehen. Aber gesät werden muss sie jetzt. Es ist die Effizienz der Verschwendung, die das bewirkt. Wer da nur an den eigenen kleinen Erfolgt denkt, wird bloß frustriert sein. Das ist menschlich verständlich, aber wenig verheißungsvoll. Der Segen Gottes, der auf Abram/Abraham liegt, ist durch Taufe und Firmung auf die Nachfolger Jesu Christi übergegangen. So schreibt Paulus:
Die Kirche ist auf dem Fundament der Apostel gebaut. Deren Lehre und Vollmachten sind in ihren Nachfolgern, den Bischöfen weiter authentisch wirksam. Die Bischöfe entsenden Priester als ihre Mitarbeiter in die Städte und Dörfer. Wer gesandt ist, darf nicht lange sitzen bleiben. Er muss zu den Menschen gehen, weil Christus ihn zu den Menschen geschickt hat:
Geht! Hinaus! In die ganze Welt! Und verkündet allen! Das ist die Aufgabe, die sich nicht nur den Geweihten, sondern auch den Ungeweihten stellt. Geht! Geht endlich! Verkündigen kann man nur, wenn man unterwegs ist. Sonst regiert der Bauch – oder, was noch schlimmer ist, das ruhegewohnte Hinterteil. Das wäre dann auch eine Form von Hierarchie. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, Alle "Wochenworte" finden Sie in unserem Weblog "Kath 2:30": Ein neuer Bus für die Citykirche
Eine Besonderheit der Arbeit der Katholischen Citykirche Wuppertal liegt in ihrem aufsuchenden Ansatz. Sie geht neue Wege zu den Menschen. Sie sucht die Menschen dort, wo sie sind - insbesondere auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Jetzt hat die Katholische Citykirche Wuppertal einen Bus anschaffen können, der die aufsuchende Arbeit unterstützt. Nachdem das Erzbistum Köln die Anschaffung bewilligt hat, freuen sich nicht nur Stadtdechant Dr. Bruno Kurth und Pastoralreferent Dr. Werner Kleine, sondern auch die anderen Mitarbeiterinnen der Katholischen Citykirche Wuppertal über das neue Gefährt. Der Ford Tourneo wird nicht nur im pastoralen Einsatz in den Innenstädten Wuppertals zu sehen sein. Er wird auch sonst in verschiedener Weise für die Katholische Kirche in Wuppertal verwendet. Blutökumene
Für verfolgte Christen ist die Einheit keine Verhandlungssache Echte Ökumene ist keine Sache theologischer Verhandlungen. Für die verfolgten Christen ist sie eine existentielle Notwendigkeit. In der Bedrohung der eigenen Existenz erweist sich die Überwindung konfessioneller Grenzen als überlebensnotwendig. Leben aus dem Tod - eine mystagogische Friedhofsführung
Gemeinsam mit den Hospizdiensten der Caritas Wuppertal/Solingen e.V. lädt die Katholische Citykirche Wuppertal zu einer "mystagogischen Friedhofsführung" auf den Kath. Friedhof Hochstr. in Wuppertal-Elberfeld ein. Diese Friedhofsführung der besonderen Art beginnt am Dienstag, dem 23. Februar 2016 um 16 Uhr am Eingang des Kath. Friedhofs (an der Friedhofskapelle). Der Tod ist wie die Geburt ein Teil des Lebens. Für Christen kommt das Leben im Tod zu sich selbst. Friedhöfe sind deshalb nicht bloß Ruhestätten. Grab- und Gedenksteine legen Zeugnis vom Leben derer ab, die hier bestattet sind – und es sind bei weitem nicht nur die Geburts- und Todesdaten, die hiervon zeugen. Die mystagogische Führung auf dem Friedhof Hochstr. erschließt die Begegnung von Leben und Tod auf eine ganz besondere Weise. Es wird deutlich: Der Tod ist kein Ende, sondern Vollendung. Dialog für Kirchenkritiker und Zweifler • 25.2.12016
Die KGI-Fides-Stelle Wuppertal lädt am Donnerstag, dem 25. Februar 2016 um 14.00 Uhr wieder zum Dialog für Kirchenkritiker und Zweifler in das Katholische Stadthaus (Laurentiusstr. 7 in Wuppertal-Elberfeld, 1. Etage) ein. Zum 25. Mal! - Dem Hl. Judas Thaddäus zur Ehre • Wallfahrt zum Patron der Hoffnungslosen am 28.2.2016
Der Hl. Judas Thaddäus gehört zu den fast vergessenen Aposteln. Er ist der Patron der Hoffnungslosen und Vergessenen. Sein Gedenktag ist der 28. Oktober. Ihm zu Ehren versammeln sich schon seit langem in Mexiko-Stadt viele, die am Rande der Gesellschaft stehen oder hoffnunglos sind, an jedem 28. eines Monats, um ihn als starken Fürsprecher anzurufen. Zusammen mit dem Sozialdienst kath. Frauen (SkF) e.V. Wuppertal, dem Caritasverband Wuppertal/Solingen, der Notfallseelsorge Wuppertal und der Seelsorge für Obdachlose, Prostituierte und Drogenabhänge lädt die Katholische Citykirche Wuppertal alle, die hoffnungslos sind oder am Rand der Gesellschaft stehen an jedem 28. Tag eines Monats nach St. Marien in Wuppertal-Elberfeld (Wortmannstr./Ecke Hardtstr.) von 12-14 Uhr ein, um den Hl. Judas Thaddäus um Beistand und Fürsprache zu bitten. Neben einem kurzen Gottesdienst and der Judas-Thaddhäus-Statue (13 Uhr) gibt es auch Gelegenheit, bei einem Mittagessen ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jede und jeder ist willkommen! Die nächste Wallfahrt findet am Sonntag, dem 28. Februar 2016 von 12-14 Uhr in St. Marien (Wortmannstr. 2 in Wuppertal-Elberfeld) statt. Um 13 Uhr wird bei der Judas-Thaddäus-Statue eine Kurzandacht gehalten. Das Projekt wird von der Metzgerei Kaufmann unterstützt. Katholische Citykirche vor Ort
Am Dienstag, dem 1. März 2016 ist die Katholische Citykirche vor Ort. Entsprechendes Wetter vorausgesetzt wird der Stand der Katholischen Citykirche Wuppertal voraussichtlich in der Zeit von 12.00-14.00 Uhr auf dem Kerstenplatz in Wuppertal-Elberfeld stehen. ansprechBAR - die offene Sprechstunde der Katholischen Citykirche Wuppertal • 3.2.2016 • Kaffee Engel
Die nächste offene Sprechstunde der Katholischen Citykirche Wuppertal findet am Dienstag, dem 2. März 2016, von 13.00-14.00 Uhr Uhr im Kaffee Engel (Friedrich-Ebert-Str. 13 in Wuppertal-Elberfeld) statt. Als Mitarbeiter der Katholischen Citykirche Wuppertal steht dann Pastoralreferent Dr. Werner Kleine zum Gespräch über Gott und die Welt, aber auch für kritische Fragen zur Verfügung. Sprechstunde für wiederverheiratet Geschiedene
Die KGI Fides-Stelle Wuppertal (Kath. Wiedereintrittstelle) lädt zu einer Sprechstunde für wiederverheiratet Geschiedene ein. Die Sprechstunde findet am Donnerstag, dem 3. März 2016 um 14.30 Uhr im Katholischen Stadthaus (Laurentiusstr. 7, 42103 Wuppertal-Elberfeld, 1. Etage) statt. Jahr der Barmherzigkeit in Wuppertal
Am 8. Dezember 2015 hatte Papst Franziskus in Rom das “Jahr der Barmherzigkeit” eröffnet. In der Verkündigungsbulle des Außerordentlichen Jahres der Barmherzigkeit “Misericordiae vultus” schreibt Papst Franziskus: Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten […].“ Die Barmherzigkeit soll gerade während des Heiligen Jahres in besonderer Weise und neu in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Neuer Kurs für erwachsene Firmbewerber
Am Mittwoch, dem 23. März 2016 startet der neue Vorbereitungskurs für erwachsene Firmbewerberinnen und -bewerber. Die Firmung wird im Rahmen einer Eucharistiefeier am Samstag, dem 14. Mai 2016 im Kölner Dom gespendet. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: Katholische Angebote in der Flüchtlingshilfe
Mit der "Aktion Neue Nachbarn" engagiert sich die Katholische Kirche auch in Wuppertal intensive in der Flüchtlingshilfe. Zahlreiche Ehrenamtliche kümmern sich um die aus ihrer Heimat durch Krieg und Verfolgung Vertriebenen. Die Katholische Citykirche Wuppertal informiert in einem Flyer über die vielfältigen Hilfs- und Beratungsangebote. Der Flyer kann im Büro der Katholischen Citykirche auch in höherer Stückzahl angefordert (Tel.: 0202-42969674) oder hier als pdf-Datei heruntergeladen werden: Do, 16. Januar 2025 - Mi, 29. Januar 2025Keine Termine gefunden Erfahrung mit GottBevor Gott einen Menschen gebraucht, schüttelt er ihn. Bevor er ihm Licht gibt, den hellen Schein, lässt er ihn in Finsternis geraten. Bevor das Wichtigste im Menschen geboren wird, lässt ihn Gott in Geburtswehen sich krümmen, hilflos und lebensgefährlich bedroht. Jesus Christus hing am Kreuz, völlig ausgeliefert, und die Sonne verdunkelte sich. So hat er dort den Bund gestiftet, den neuen Bund. Gott verbündet sich nur mit neugewordenen Menschen und wenn er sich uns dazu nähert, dann geht es mit uns ans Sterben. Aber das ist ein Sterben voll Leben, eine Angst voll Freude, eine Hilflosigkeit voll Geborgenheit, ein Ende voll Zukunft. |

|
Katholische Citykirche Wuppertal, Laurentiusstr. 7 42103 Wuppertal |
|
Tel.: +49 (0)202-42 96 96 74 Fax: +49 (0)202-42 96 96 77 info@katholische-citykirche-wuppertal.de |
Copyright © Katholische Citykirche Wuppertal, 2012 Made by Design Schoenbach |
Impressum
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail and its attachments is strictly forbidden.