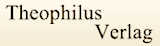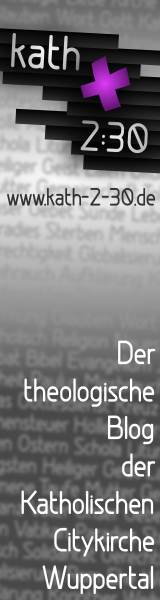Die Revolution frisst ihre Kinder
Ende der Siebzigerjahre galt die sandinistische Revolution in Nicaragua vielen als Alternative zu Kapitalismus und autoritärem Sozialismus. Im vorvergangenen Jahr ließ der ehemalige Revolutionär und amtierende Präsident Daniel Ortega auf Studenten schießen. Bericht aus einem desillusionierten Land.
Ein Feature von Øle Schmidt
Als der Lastwagen vor der Nationalversammlung vorfährt, brandet Jubel auf. »Freies Vaterland oder Tod!«, schallt es über den großen Platz. Die schwarzrote Fahne der siegreichen sandinistischen Guerilla FSLN flattert im Wind. Die Guerilleros auf der hoffnungslos überfüllten Ladefläche halten ihre Gewehre triumphierend in den Himmel. Als Antwort schnellen tausende Fäuste geballt in die Höhe. Endlich! Mehr als vierzig lange Jahre hatten sie in dem kleinen mittelamerikanischen Land auf den Sturz des verhassten Somoza-Clans gewartet. Es ist ein denkwürdiger Aufmarsch an diesem 19. Juli 1979 auf dem Platz der Revolution in der Hauptstadt Managua.
Mit frenetischem Beifall bedacht wird damals auch ein schmächtiger Mann mit großer Brille in olivfarbener Uniform: Comandante Daniel Ortega. »Das vereinte Volk kann niemals besiegt werden!«, rufen die Massen im Siegesrausch. Dass Daniel, wie er von allen genannt wird, als Präsident einmal auf unbewaffnete Studenten schießen lassen würde, und die freiheitliche Revolution der Sandinisten zu einer Familiendiktatur verkommt – das ist an diesem Tag der Freude undenkbar.
»Ich hatte Nachtschicht bei Thyssen in der Fabrik«, erzählt Leo mit breitem Ruhrpott-Akzent, während er über den wie leer gefegten Revolutionsplatz schlendert. »Von der Revolution habe ich erst einen Tag später erfahren.« Leo ist nicht sein richtiger Name, wie viele andere ist der Deutsche in Nicaragua von Gefängnis und Ausweisung bedroht. »Damals habe ich mitbekommen, dass die Sandinisten versuchen, eine andere Gesellschaft aufzubauen«, erinnert sich der Fünfundsechzigjährige. »Mit mehr Gleichheit und Gerechtigkeit, aber ohne stalinistische Methoden.«
Vor allem junge Menschen im vom kalten Krieg geprägten Westdeutschland sehen damals im Sandinismus eine freiheitliche Alternative zu imperialem Kapitalismus und autoritärem Sozialismus. Leo wird vom Sympathisanten zum Aktivisten und siedelt Mitte der Achtzigerjahre ins »gelobte Land« über, wie er lachend erzählt. Dort muß er mitansehen, wie die Revolution nach hoffnungsvollen Anfangsjahren irgendwann vor die Hunde geht.
»Die USA haben das sandinistische Experiment mit ihrem Contra-Krieg zerstört, Ortega und Consorten haben es verraten mit ihrer autoritären und machtgierigen Politik«, sagt Leo. Im vergangenen Frühling dann entlädt sich die Wut vieler Nicaraguaner in friedlichen Demonstrationen. Die Staatsmacht schlägt brutal zurück.
Die Leichen sind abtransportiert, die Blutlachen von den Straßen gewischt, und die Einschusslöcher der Kalaschnikows verputzt. Auf dem Weg zu der Oppositionellen Mónica Baltodano erinnert äußerlich nichts mehr an die Tage im vergangen Jahr, als Präsident Ortega auf sein Volk schießen ließ, und die Welt mit zügelloser Gewalt schockierte.
»Da drüben an der Polytechnischen Universität hat alles angefangen«, sagt Leo, während er mit seinem kleinen Auto waghalsig auf die Hauptstraße abbiegt. Erst der tagelange Brand im Naturschutzreservat Indio Maíz, dann das Gesetz über die Kürzungen der Renten. Vor allem Studenten zeigen im Frühling 2018 friedlich ihren Unmut. »Auf dem Campus sind sie dann von Polizisten mit Kriegswaffen beschossen worden«, erzählt Leo. In den kommenden Monaten weitet sich der Protest zu einem landesweiten Aufstand gegen Daniel Ortega und seine Familie aus. Bis zum Ende des Jahres beklagen Menschenrechtler bis zu 500 Tote.
Als Leo 1983 in der taz einen Aufruf für eine dreimonatige Arbeitsbrigade in Nicaragua liest, zögert er nicht. Wegen Terrorismusverdachts verweigert der Frankfurter Flughafen jedoch die Starterlaubnis für die 150 jungen Deutschen. »Nachdem uns die Polizisten verprügelt hatten, sind wir nach Luxemburg ausgewichen«, erinnert Leo sich. Auf dem Rollfeld des Flughafens von Managua begrüßt Kulturminister Ernesto Cardenal die Brigadisten. Ein Charismatiker mit vollem Bart und Baskenmütze, der von sich sagt: »Ich bin Poet, Priester und Revolutionär.«
Der 23-Jährige Leo besucht Gesundheits- und Bildungsprojekte der Revolutionsregierung unter Daniel Ortega, er verfolgt die Alphabetisierungskampagne und die Landreform. »Die Sandinisten haben der Landbevölkerung ihre Würde zurückgegeben« sagt er anerkennend, »die Bauern galten vorher als minderwertig und dumm.« Der tropische Sozialismus hat Platz für oppositionelle Parteien und Privatwirtschaft, er schützt Menschenrechte und Religionsfreiheit.
Leo kämpft sich durch den dichten Verkehr in der Hauptstadt. »Hier stand die Reiterstatue von Diktator Anastasio Somoza Debayle«, er zeigt auf das verfallene alte Nationalstadion. Noch am Tag des Sturzes der Somoza-Diktatur stürzen Demonstranten freudig auch den Diktator vom Sockel. »Die Statue war übrigens ein Geschenk vom Faschisten Mussolini«, sagt Leo spöttisch.
Mónica Baltodano kämpft sich in ihrem kleinen Büro durch eine Flut unbeantworteter Emails. Die prominente Ortega-Kritikerin ist gefragt in diesen Tagen. Von einem Plakat grüßt der Befreiungsheld Augusto Sandino. Den Triumph der Sandinisten erlebt Mónica Baltodano als Kämpferin auf dem Revolutionsplatz. »Ich war in Granada und wir haben uns mit den Guerilla-Einheiten darauf vorbereitet, Richtung Managua zu ziehen«, erinnert sich die Siebenundsechzigjährige. »Als ich dort nachmittags ankam, habe ich tief eingeatmet, und an die gedacht, die gefallen sind, auch an meine Schwester.«
Die Frau mit den Locken und den feinen Gesichtszügen verkörpert jene exotische Mischung, die der Revolution damals auch in Deutschland eine besondere Strahlkraft gibt: Sandino, Marx und Jesus. In der Schule kommt Mónica Baltodano in Berührung mit der Theologie der Befreiung, die Gott an der Seite der Armen sieht. Die Nonnen kritisieren die bedrückende Armut in Nicaragua. Als Neunzehnjährige schließt sie sich 1974 der Guerilla an. »Für uns war klar, dass das Paradies für die Armen nicht erst im Himmel beginnt«, sagt sie, während ihr Handy unaufhörlich klingelt. »Wir waren überzeugt, dass das Königreich, die andere Gesellschaft, hier auf Erden aufgebaut werden muss.«
Die imperiale Politik der USA, der diktatorische Somoza-Clan und Augusto Sandino – drei wesentliche Bezugspunkte des Sandinismus. Der Sozialrevolutionär mit dem berühmten schwarzen Hut kämpf mit Getreuen gegen die US-Truppen, die Nicaragua seit 1912 besetzt halten. Vor ihrem Abzug 1933 setzt Washington Anastasio Somoza García als Statthalter ein, der daraufhin Sandino hinterrücks ermorden lässt. Erst die sandinistische Revolution beendet die Herrschaft des Somoza-Clans.
Damals arbeitet Mónica Baltodano unter Daniel Ortega im Präsidialamt und in der nationalen Leitung der sandinistischen FSLN, die mittlerweile eine Partei geworden ist. Wegen der zunehmend undemokratischen und autoritären Politik Ortegas verlässt sie Ende der Neunzigerjahre ihre politische Heimat. »Die FSLN als Partei hat sich Stück für Stück von Ortega und einer Gruppe von Fanatikern gefangen nehmen lassen«, erzählt sie rückblickend. »Er hat sein eigenes System aufgebaut, in dem er die Mystik und Symbolik der Partei missbraucht hat. Seine Politik hatte schon lange nichts mehr mit Sandinismus zu tun, wir nennen es Orteguismus.«
Es war ein langer Weg vom einst freiheitlichen Sandinismus zur Diktatur der Familie Ortega. Nach dem Sieg der Revolution tut sich die junge Partei schwer, die erprobte militärische Befehlsstruktur abzulegen. Auch der schnell einsetzende Krieg der von den USA bezahlten paramilitärischen Einheiten, die sich Contras nennen, verhindert den Aufbau einer demokratischer Diskussionskultur. 1985 wird Daniel Ortega erstmals zum Präsidenten gewählt. Nach der unerwarteten Wahlniederlage 1990 greifen sandinistische Funktionäre in die Staatskasse. Auf dem Weg zurück zur - diesmal alleinigen - Macht paktiert Ortega mit korrupten Politikern, der erzkonservativen katholischen Kirche und einflussreichen Unternehmen.
Nach seiner Wiederwahl im Jahr 2006 zeigt er sich als Chamäleon. Vor seinen Anhängern läutet Daniel Ortega die »zweite Etappe der Revolution« ein, hinter verschlossenen Türen stimmt er mit dem Unternehmerverband seine neoliberale Wirtschaftspolitik ab. »Nie haben Banken in Nicaragua größere Gewinne als unter seiner Präsidentschaft gemacht«, sagt Mónica Baltodano. »Nie war es einfacher für internationale Firmen, Geld in Nicaragua zu verdienen, nie wurde die Natur so schamlos zerstört. Ortegas freibeuterische Politik straft seinen öffentlichen Diskurs von ’christlich, sozialistisch und solidarisch’ Lügen.«
Während sein Volk im vergangenen Jahr gegen ihn demonstriert, verkündet Ortega, dass die vom »nordamerikanischen Imperium« finanzierten »Satanisten exorziert werden müssen.« Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes beginnt Präsident Ortega mit seiner Vizepräsidentin, seine Ehefrau Rosario Murillo, die »Operación limpieza«, die Säuberungsaktion. Oppositionelle werden willkürlich verhaftet oder verschwinden, Fernsehsender werden gestürmt und NGOs verboten, Ärzte werden entlassen, weil sie verletzte Demonstranten behandelt haben. Der Rechtsstaat wird abgeschafft, die Justiz urteilt politisch.
Im Dezember spitzt sich für Mónica Baltodano und ihren Mann die Lage zu. Paramilitärs überfallen nachts das Büro ihrer Stiftung Popol Na. »Wir haben uns wochenlang versteckt, weil wir dachten, jetzt verhaften sie uns«, sagt sie. »Doch wir haben entschieden, der Diktatur die Stirn zu bieten.«
Mónica Baltodano kann der dramatischen Lage etwas Positives abgewinnen. »In Nicaragua wird derzeit diskutiert, dass der Weg aus der Diktatur heraus ein ziviler und gewaltfreier sein muss«, sagt sie. »Das drückt sich am besten in der neuen Losung der Demokratiebewegung aus: ›Freies Vaterland und Leben‹, früher hieß es ›Freies Vaterland oder Tod.‹«
Die ehemalige Guerillakämpferin plädiert für einen friedlichen Tyrannensturz. Sie, die einen Platz im sandinistischen Pantheon sicher hat, weil sie als Comandante für den in Nicaragua legendären »strategischen Rückzug« mitverantwortlich war, der als wichtig für die Revolution gilt. Später dann erforscht Mónica Baltodano die Geschichte des sandinistischen Kampfes. »Und jetzt muss ich feststellen«, sagt sie leise, »dass viele, die in meinen Büchern Helden waren, zu Mördern geworden sind. Das schmerzt sehr.«
Die Hauptstraße ist gepflastert mit Ortega-Plakaten, auf denen er als »Präsident des Volkes« gefeiert wird. Leo biegt in einen Kreisverkehr am Einkaufszentrum Metrocentro ein. Wie aus dem Nichts tauchen fünfzig Polizisten in martialischer, schwarzer Uniform auf. »Die Aufstandsbekämpfer sind berüchtigt für ihre Skrupellosigkeit«, sagt Leo. »Men in Black« steht auf einem Werbebanner über dem Eingang, »demnächst hier im Kino.«
Leo geht 1987 für das Wuppertaler Informationsbüro Nicaragua, das inzwischen mehr als hundert deutsche Solidaritätsgruppen koordiniert, in das mittelamerikanische Land. Dort betreut er die vielen Brigadisten, die ehrenamtlich bei der Kaffeernte und dem Bau von Schulen helfen. Der Antiautoritäre wird mit dem Machtmissbrauch einiger sandinistischer Funktionäre konfrontiert. »Bei der Landarbeitergewerkschaft bekam die Führungsschicht zwei Gehälter. Ein offizielles in der Landeswährung, und für Luxusartikel ein üppigeres in Dollar.«
Als Leo bemerkt, dass bei einem deutschen Solidaritätsprojekt eine stattliche Summe fehlt, weiß er, woher das Geld kommt für die geheimen, zweiten Gehälter. »Für mein Schweigen haben mir die Funktionäre eine Finca angeboten, ein großes Anwesen auf dem Land«, sagt er. »Als ich ablehnte, haben sie mir mit dem Tod gedroht.«
»Hier steht das neue Nationalstadion«, sagt Leo, und dreht die Klimaanlage höher. »Bei der Muttertagsdemo im vergangenen Jahr waren dort Polizisten und Paramilitärs postiert.« Hunderttausende Frauen, Männer und Kinder gedenken an diesem Nachmittag der Toten des Widerstandes. »Als sie am Nationalstadion vorbeiziehen, eröffnen Scharfschützen das Feuer. Die haben skrupellos in eine friedliche Demonstration geschossen«, sagt Leo fassungslos.
Seit Beginn der Neunzigerjahre muss Leo in Nicaragua mitansehen, wie der frühere Guerilla-Kommandant Daniel Ortega die Ideale der ehemals gemeinsamen Sache verrät. Auf seinem Weg zur alleinigen Macht übernimmt er in einem kalten Putsch die Kontrolle wichtiger Institutionen. Ortega bricht die Verfassung, setzt Familienmitglieder in Schlüsselpositionen und bereichert sich. »Militärs können nicht die Träger eines Veränderungsprozesses sein«, sagt Leo. »Wir sehen ja, wo das hinführt, es endet in korrupten Regimen und Militärdiktaturen.«
Auf einem großen Ortsschild ist Jesus vor kitschig-jenseitigem Panorama mit Schafen auf grüner Weide zu sehen. Nachsichtig lächelnd erinnert er daran, dass nur er der Hirte im Diesseits ist. »An der katholischen Kirche kommt im tief religiösen Nicaragua niemand vorbei«, sagt Leo, »Diktatoren nicht, und Aktivisten nicht.«
Der Ventilator in dem vollgestellten Büro in der Jesuiten-Universität führt einen aussichtslosen Kampf gegen die tropische Hitze. »Heute ist es besonders schlimm«, stöhnt María López Vigil. »Ich war an jenem Tag in der Dominikanischen Republik«, erinnert sich die renommierte Autorin und Journalistin, »und hatte vorher das Versprechen abgelegt, dass ich meine langen Haare abschneiden lasse, wenn die Revolution siegt. Als mich die freudige Nachricht erreichte, habe ich dem Gärtner die Heckenschere gegeben.«
Wenige Jahre später wird María López Vigil von den Jesuiten nach Managua eingeladen, um das sozialwissenschaftliche Magazin envio aufzubauen. Willkürliche Verhaftungen, Folter, geheime Hinrichtungen – was ist dran an den internationalen Vorwürfen gegen das Ortega-Regime? Die 75-Jährige schweigt beharrlich zu aktuellen politischen Fragen. Sie weiß, warum.
In Deutschland wird die sandinistische Revolution mit Ernesto Cardenal und anderen Befreiungstheologen verbunden. »Zweifellos hat die Theologie der Befreiung ihren Platz in der Geschichte Nicaraguas«, sagt María López Vigil und guckt dabei streng. »Ihr Einfluss wird jedoch in Europa überschätzt. Und die Sandinisten haben die Attraktivität dieser praktisch orientierten Bibelauslegung für ihr politisches Projekt genutzt.«
Ihre Ursprünge hat die Befreiungstheologie im Lateinamerika der Sechzigerjahre. Priester rufen damals in Gottesdiensten zur Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung auf. Die Mitglieder christlicher Basisgemeinden verpflichten sich zum gelebten Glauben im Diesseits.
Eines der bekanntesten Werke von María López Vigil ist das Buch »Ein anderer Gott ist möglich – 100 Interviews mit Jesus«. Was hätte Jesus 1979 zur Revolution der Sandinisten gesagt? »Er hätte applaudiert, dass die Diktatur gestürzt wurde. Und er hätte den Sandinisten geraten, Gott besser Gott sein zu lassen. Doch sie haben sich selbst zu Göttern erhoben. Und die Konsequenzen dessen sehen wir heute in der Ortega-Diktatur.«
Graue Haare, blaues Sommerkleid, rot lackierte Fußnägel; mit verständnisvollem Blick reicht María López Vigil Papiertücher gegen den strömenden Schweiß. »Man darf auch nicht vergessen, dass die Sandinisten nur sehr wenig Zeit für die Verwirklichung ihrer Ideale hatten, bevor der Krieg begann.«
Zwei Jahre nach der Revolution überziehen die Contras Nicaragua mit Terror. Sie greifen Erdöl-Depots an, sprengen Pipelines und vernichten so einen Großteil der Ölvorräte. Sie verminen und bombardieren Häfen, um Exporte zu verhindern. Die Söldner zerstören Straßen, Brücken und Farmen. »Der Krieg der USA gegen Nicaragua ist ein wesentlicher Grund für die vielen Probleme, die damals entstanden sind«, sagt María López Vigil.
»Was wir heute in Nicaragua und anderswo erleben, ist zudem ein Erbe der Kolonialzeit, als Spanier und Portugiesen Lateinamerika als ihre Finca betrachteten. Diktatoren«, formuliert die Intellektuelle bewusst vage, »haben dieses Selbstverständnis übernommen, und sehen ihr Land als Privatbesitz, und sich als absolutistische Herrscher.«
Im vorvergangenen Frühling hätten die Nicaraguaner aufgehört, Knechte ihres Finca-Besitzers zu sein, und ihre Rechte einzufordern. Doch ein solcher Wandel gehe nicht gegen die katholische Kirche, der wichtigsten moralischen Instanz Nicaraguas. Und die stand lange Zeit an der Seite Ortegas. Bis zum Ausbruch der staatlichen Gewalt.
»Die große Mehrheit der Priester, Mönche, aber auch der Bischöfe, haben die Menschen und ihren Aufstand unterstützt«, sagt María López Vigil. »Sie haben Menschen versteckt, Verletzte behandelt, und so das Wesentliche des Evangeliums umgesetzt.«
Zurück auf dem Revolutionsplatz im Herzen der Altstadt. Die prachtvollen Bauten erzählen von der jüngeren Geschichte Nicaraguas – auch von der Hybris der jeweils herrschenden Diktatorenfamilie. Die eingestürzte Kathedrale erinnert an die Verbrechen des Somozoa-Clans. Als 1972 Tausende einem Erdbeben zum Opfer fallen, bereichert sich die Familie an den internationalen Hilfsgütern. »Die haben selbst die gespendeten Blutkonserven zu Geld gemacht«, sagt Leo kopfschüttelnd.
Der Nationalpalast ist frisch gestrichen, am Eingang hängt ein langes Banner. »Sandino, wir erfüllen deinen Auftrag«, darunter eine überlebensgroße Unterschrift: »Daniel, 2007«. »Ortega pflegt einen irren Personenkult«, kommentiert Leo dessen Strategie, die Revolution nachträglich zu seiner Privatsache zu erklären.
Das Sonnenlicht bahnt sich seinen Weg durch das marode Dach der baufälligen Kathedrale. Auf einem Transparent über dem Eingang steht ein Ausspruch des Nationaldichters Rubén Darío: »Wenn das Vaterland auch klein ist, umso größer sind die Träume.«
Desillusioniert ist Leo heute, 40 Jahre nach dem Einmarsch der Kämpfer auf den Revolutionsplatz. Nicht aber entmutigt. Der frühere sandinistische Aktivist sieht das Entstehen einer Zivilgesellschaft im Agrarland Nicaragua als späte Frucht der Revolution. In der autonomen Frauenbewegung, in unabhängigen Bauernkooperativen und NGOs hätten sich selbstbewusste Menschen organisiert, die sich gegen Obrigkeiten auflehnten.
»Einerseits ist die Revolution gescheitert, und doch hat sie gleichzeitig das Gegengift zu der Diktatur entwickelt, das es jetzt gerade braucht«, während Leo spricht, blitzt in seinen Augen Kampfeslust auf. »Die Revolution hat die Kräfte zur Überwindung der Ortega-Diktatur erst ermöglicht. Deswegen war sie auch nicht umsonst!«


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz