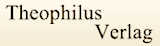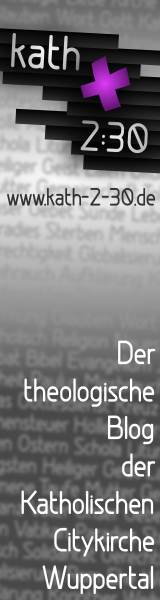Ausgabe 9, Juli 2013
Die Stadt
Von Häusern, Wegen und Menschen
Text Dr. Werner Kleine
Es ist – mit Blick auf die Menschheitsgeschichte – noch nicht allzu lange her, da galt die Stadt als Inbegriff der Freiheit. Stadtluft macht frei, so hieß es im Mittelalter. Dahinter stand der Rechtsbrauch, dass Leibeigene, die sich von ihren Grundherrn abgesetzt hatten, häufig in Städte flohen. Wer dort ein Jahr und einen Tag lebte, ohne von seinem Dienstherrn zurück gefordert zu werden, wurde zum freien Stadtbewohner.
Der Stadt galt die Sehnsucht der Menschen. Demgegenüber kann man heute eine Stadtflucht konstatieren. Die Veröffentlichung der Zensusdaten belegt: Während die Bevölkerung in den ländlichen Gemeinden wächst, haben fast alle Städte weniger Bürger zu verzeichnen als ursprünglich angenommen. Die Stadt ist kein Ort der Sehnsucht mehr. Die Stadt wird zur Last. Bürger zu sein, ist offenkundig keine Ehre mehr, es ist zur lästigen Pflicht geworden. Wer heute noch Bürger einer Stadt ist, erfreut sich nicht der Freiheit, sondern er klagt über die steigenden Gebühren für Abwasser und Winterdienst, über die Grundabgabensteuer und den Dreck auf den Straßen, beschwert sich über die vermeintliche Unfähigkeit, eine funktionierende Infrastruktur zu organisieren, und die Eitelkeit der Stadtoberen, die sich im Glanz ihrer Ämter sonnen.
Eine Kulturkatastrophe
Angesichts dieser Bürgerstimmung bezeichnet sich manch einer gerne auch als Wutbürger. Das sagt viel über die gefühlte Ohnmacht aus, die der Mensch von heute gegenüber den politisch Handelnden und den wirtschaftlich Mächtigen empfindet. Dabei vollzieht sich das Bürgerrecht nicht in sarkastischen Leserbriefen, die in den Onlineforen der Tageszeitungen zu lesen sind.
Die Stadt als ehemaliger Ort der Ermöglichung des freien Lebens ist zu einem Ort des Überlebens degeneriert. Die Stadt hat als Burg der Bürger, die als kulturierter Ort Schutz vor den Katastrophen der Natur bot, ausgedient; stattdessen wird sie selbst zum Dschungel, in dem sich der Einzelne verirrt.
Die Stadt auf dem Berg
Die Kirche hat ihren Anteil an dieser Kulturkatastrophe. Die Pfarrgemeinde, früher Hort gemeinschaftlicher Beziehungen und Kommunikationen, gibt es so nicht mehr. Pfarreien sind heute nicht selten Verwaltungseinheiten für mehrere Stadtteile, in denen man sich nicht mehr kennt. Dabei weist das Wort „Pfarrei“ genau in die andere Richtung. Es ist ein Lehnwort, das vom griechischen Begriff „paroikia“ abgeleitet ist. Paroikia heißt soviel wie „nah beim Haus“.
Die kirchliche Entwicklung der vergangenen Jahre, die auch an Wuppertal nicht spurlos vorübergeht – wie die Großpfarreien der katholischen Kirche und die drohende Schließung von evangelischen Kirchen zeigen – wird zwangsläufig zu einem Bedeutungsverlust führen. Was für die Welt gilt, gilt auch für die Kirche. Sie ist ja immer eine Kirche in der Welt. Dabei versteht sich die Kirche nach einem Wort Jesu selbst als „Stadt auf dem Berg“. Die Kirchen könnten und sollten ein Vorbild für die Stadt von Welt sein. Vielleicht befinden sich viele Städte nicht zuletzt deshalb in einer Krise, weil die Kirchen ihre identitätsstiftende Funktion nicht mehr ausüben können. Wo man sich nicht mehr kennt, kann man sich nicht mehr grüßen. Wo man nicht wohnt, entsteht keine Heimat. Wo man nicht lebt, schlägt man keine Wurzeln.
Urbs resurrecta
Es gehört zur christlichen Grundhaltung, Krisen nicht als ausweglose Katastrophen, sondern als Chance zur Reifung zu begreifen. Die denkbar größte Krise, der Tod, hat nicht das letzte Wort. Eine Auferstehung ohne Tod allerdings ist nicht denkbar.
Die gegenwärtige Krise der Kirche als „Stadt auf dem Berg“ ist durch einen Bezugsverlust verursacht, dessen Symptom die Auflösung gemeindlicher Nahbeziehungen in pfarrlichen Großstrukturen ist. Dieser Bezugsverlust selbst hat seinen Grund in einem Schwund an alltäglicher Lebensrelevanz. Der in Sonntagspredigten verkündete Glaube trägt den Alltag und seine Probleme nicht mehr. Das klerikal Gesagte ist zwar erwartbar, für das konkrete Leben aber allzu oft nicht mehr relevant.
Dabei war das Christentum von Anfang an eine Stadtreligion, die die Alltagskultur ergriff. Wenn die gegenwärtige Krise überwunden werden soll, muss sich der Glaube wieder dieser Alltagskultur annehmen. Er muss sich im Alltag verwurzeln. Dafür braucht es Fachleute, die den Alltag kennen. Diese Fachleute sind da. Es sind die einfachen Christinnen und Christen, die die Probleme des Alltags leben und immer wieder lösen. Wenn sich die Kirche traut, aufzuerstehen, dann wird sie mit diesen Experten des Alltagsglaubens eine neue Kultur hervorbringen – eine Kultur, die sich nicht in steinernen Denkmälern vergangener Glaubensgewissheit manifestiert, sondern aus lebendigen Steinen besteht. Diese Kirche wird wieder nah beim Haus – Paroikia – sein können. Sie kehrt zurück zu den Anfängen der Kirche, als man sich in den antiken Städten in Wohnhäusern traf. Dort lag die Keimzelle für die christliche Stadtkultur, die fortan die Städte Europas geprägt hat.
Vor der eigenen Tür anfangen
Nah beim Haus beginnt die Stadt. Die Stadt ist vor der eigenen Tür. Wer nur darauf wartet, dass „die Stadt“ endlich etwas tut, hat noch nicht verstanden, dass die Stadt aus Bürgern besteht. Dass ein solches Bürgerbewusstsein in Wuppertal längst lebendig ist, zeigen die vielen ehrenamtlichen Initiativen, die sich nicht nur um das Entstehen der Nordbahntrasse oder den Erhalt von Schwimmbädern kümmern, sondern auch die Stadtviertel Wuppertals lebendig machen. Manches steht in Konkurrenz zueinander. Das kann beleben, aber auch blockieren. Das alte, früher sehr erfolgreiche katholische Prinzip sollte hier in der Stadt wie in der Kirche wiederentdeckt werden: Ein Organismus entsteht aus vielen Gliedern. Wir leben nah beim Haus, sind aber mit den Nachbarn durch Wege, Gassen und Straßen verbunden. Die Kirche muss wieder ins Dorf! So ersteht eine neue Stadt!


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz