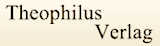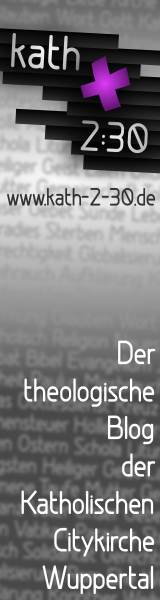Ausgabe 19, April 2018
Orte der Ohnmacht
Der Umgang mit dem Tod und die Kultur des Trauerns verändern sich
 Langsam verblasst das Gedenken an Abdullah, zumindest die Farbe auf der Steinwand.
Langsam verblasst das Gedenken an Abdullah, zumindest die Farbe auf der Steinwand.
Aber anders als ein Grabstein, war es für lange Zeit sehr präsent.
Text Dr. Werner Kleine
Fotos Christoph Schönbach
Die viel beschworene Unfähigkeit des modernen Menschen zur Trauer erweist sich als Trugschluss. Die Art zu Trauern findet neue Formen, wenn das Private öffentlich wird.
Kreuze blühen am Wegesrand. Meist von nahen Angehörigen, nicht selten aber auch von engen Freunden aufgestellt, markieren sie Orte, an denen ein Mensch gestorben ist. Diese Orte lassen darauf schließen, dass der Tod plötzlich und unerwartet kam. Die Lebenszeit wurde zerrissen. Tote haben keine Zeit mehr. Die, die zurückbleiben müssen, sind hingegen dem Zeitenriss ohnmächtig ausgeliefert.
Wer mit offenen Augen durch Stadt und Land geht oder fährt, kann diese Orte oft sehr persönlicher Trauer wahrnehmen. Sie spotten der immer wieder geäußerten Ansicht Hohn, der moderne Mensch würde den Tod aus dem Leben verbannen. Das Gegenteil scheint da doch eher der Fall zu sein, wenn etwa an der Mirker Straße/Ecke Uellendahler Straße über Monate hinweg Kerzen brannten und an den tödlichen Autounfall Abdullahs im September 2014 erinnerten. Familie und Freunde hielten die Erinnerung an den jungen Mann an dem Ort wach, an dem er starb. Noch heute erinnern Graffitis an der Mauer an das Geschehen. Mitten in der Stadt, an dem Ort des Sterbens, bleibt der Tod präsent. Wohl kaum jemand, der an der Ampel steht, kann sich dem Gedenken entziehen.
Trauer ist unbezahlbar
Das Private wird öffentlich. Während die Orte der öffentlichen privaten Trauer zahlreicher werden, stehen die Friedhofsverwaltungen vor neuen Herausforderungen. Der Trend zu Urnenbestattung ist nicht nur ungebrochen, er bringt auch mit sich, dass eine Bestattung weniger Fläche braucht als zu Zeiten, in denen man die Angehörigen selbstverständlich in Särgen beisetzte. Viele Friedhöfe erscheinen angesichts dieser Entwicklung geradezu überdimensioniert. Zahlreiche Grabflächen bleiben ungenutzt – die Kosten für den Unterhalt hingegen bleiben gleich.
Aber nicht nur das zwingt viele Friedhofsverwaltungen zum Umdenken. Auch wenn in Wuppertal bis auf den städtischen Friedhof in Ronsdorf alle Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft sind, und dort grundsätzlich keine anonymen Bestattungen stattfinden, findet diese Bestattungsart nicht selten aus Kostengründen andernorts zunehmend Beachtung. Das Leben ist gelebt, im Tod sind alle gleich. Die Kerzen, die dann aber auf den anonymen Rasenflächen oder auf den davor präparierten Flächen zu Hauf brennen, zeigen hingegen, dass das Bedürfnis nach einem Ort der Trauer ungebrochen ist. Der Tod mag das Leben nehmen, nicht aber die Trauer der Hinterbliebenen, die auch das eingesparte Geld nicht leichter werden lässt.
Trauer braucht Orte
Der Kontrast zwischen den Orten der öffentlich zelebrierten privaten Trauer und den gar nicht so anonymen Gräberfeldern zeigt, dass Trauer einen Ort braucht. Der Mensch ist aus christlich-jüdischer Sicht immer eine Einheit von Leib und Seele. Das rein Geistige braucht den Leib, das Somatische, um sich äußern zu können. Der Leib ist eine conditio sine qua non, eine Bedingung, ohne die der Mensch nicht sein kann. Das gilt, schon rein irdisch gesprochen, offenkundig über den Tod hinaus. Trauer muss sich äußern können, sie braucht ein Gegenüber, einen Ort, an dem das Unbegreifliche des Todes doch einem Versuch des Begreifens unterzogen wird. Das klassische Grab reicht dafür offenkundig nicht mehr aus. Vielmehr werden seit jeher letzte Erinnerungen aufgehoben, letzte Worte überliefert, die letzten Orte aufgesucht. Wenig unterscheidet da im Grundsatz die Grabeskirche in Jerusalem von dem Stromkasten an der Mirker Straße/Ecke Uellendahler Straße in Wuppertal-Elberfeld. Beides sind Orte, an denen jemand aus Raum und Zeit in die Ewigkeit eingegangen ist. Beides sind Orte, die von denen aufgesucht werden, die den ohnmächtigen Versuch unternehmen, etwas von dem Gegangenen doch noch greifen zu können, etwas, das bleibt, weiterlebt im Hier und Jetzt.
Ein Name ist ein Name
Die geldwerte Unfähigkeit, Anonymität auszuhalten, steht in Kontrast zu einer neuen Bestattungskultur, die Individualität feiert. Särge und Urnen werden von Angehörigen zu Unikaten gestaltet, während andere sich schon zu Lebzeiten in Fried- und Trostwäldern den einzigartigen Baum aussuchen, unter dem sie die eigenen Überreste gut aufgehoben wissen möchten. Auch im Tod bleibt der Mensch einzigartig. Der Psalmist hat Recht, wenn er singt: „Wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr.“ (Psalm 103,15f) Das gilt zweifelsohne für das Leben des Menschen. Die am Wegrand blühenden Kreuze zeugen hingegen von der Sehnsucht, wenigstens die Namen der Menschen bleibend zu wissen. Wenn die Namen der Toten auf die Mauern der Städte gesprüht werden, dann wird damit auch eine Verheißung Gottes Wirklichkeit, die Jesaja überliefert: „Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, deine Mauern sind beständig vor mir.“ (Jesaja 49,16)
 2014 starb Abdullah Cetin an der Ecke Uellendahler Str./Eckenförder Str.
2014 starb Abdullah Cetin an der Ecke Uellendahler Str./Eckenförder Str.
Ein Name ist mehr als ein Name. In ihm bekommt die Erinnerung eine Gestalt. Wenn der Tod am Wegesrand seine Blüten treibt, dann zeigen die Lebenden, dass sie um seine Macht wissen, überall unerwartet sein zu können. Und sie zeigen ihm doch seine eigene Ohnmacht – denn die Namen bleiben.


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz