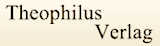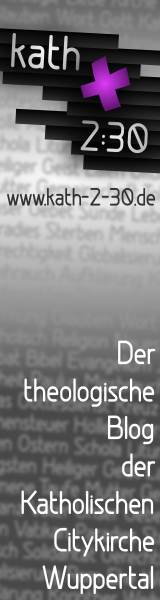Ausgabe 17, Juni 2016
Don´t panic!
Warum wir Säbelzahntiger gefährlicher finden als Waffen – und wie wir unsere Ängste besiegen können.

Text JANINA KUSTERKA
Grafik Christoph Schönbach
Zuerst werden die Schatten länger und länger, dann ist es plötzlich dunkel. Erleuchten in der Stadt zumindest die Lichter von Straßenlaternen und Reklametafeln auch die dunkleren Ecken, leuchten hier höchstens die winzigen Sterne. Der Stumpf der gefällten Eiche ragt zerklüftet in den dunklen Himmel. Die Äste der Sträucher versuchen jeden Vorbeigehenden am Kragen zu packen, und strecken ihre knochigen Finger nach ihnen aus. Sie kratzen an der Jacke, verursachen Gänsehaut. Je weniger die Augen tatsächlich sehen, desto mehr übernehmen die Ohren und das Gehirn. Das, was eben noch wie ein Baum aussah, verändert sich und wird zu einem Mann, einem Mann mit einer Maske. Und der hat eine Axt, ganz sicher. Da knackt es auch schon im Geäst, die Bäume rücken weiter zusammen, versperren die Fluchtwege. Das Herz klopf stark von innen an die Brust, so als wollte es schon vor den Füßen wegrennen, Hauptsache weg von dem Maskenmann mit der Axt. Das Knacken des Waldes wird langsam leiser. Lauter ist jetzt das Rauschen des Blutes in den Ohren, das Klopfen des Herzens, selbst die Schweißtropfen scheinen geräuschvoll von der Stirn auf den feuchten Waldboden zu tropfen. In diesem Moment gibt es zwei Alternativen: Kampf oder Flucht.
Angst und Körper
„Körperliche Angstsymptome wie ein beschleunigter Herzschlag mobilisieren unsere Kräfte und warnen vor der Bedrohung“, erklärt Signe Achterberg. Sie ist Psychologin und leitet verschiedene Angst-Therapiegruppen. „Wir bekommen kalte Hände, weil das Blut in den Beinen gebraucht wird, um schneller laufen zu können. Wir schwitzen, um bei einer möglichen Flucht oder einem Kampf nicht zu überhitzen. Diese körperlichen Reaktionen gehen von null auf hundert, sobald man eine mögliche Bedrohung sieht oder hört.“ Entwicklungsgeschichtlich sitzt Angst im ältesten Teil des Gehirns: in der Amygdala. Gefahren zu sehen und rechtzeitig vor ihnen zu fliehen, das ist eine Fähigkeit, die im Zweifel über Leben und Tod entscheidet. Die Ängste, die Personen überkommen, die beispielsweise durch einen dunklen Wald gehen, sind instinktive Ängste.
Das verdächtige Rascheln wird über den Thalamus geleitet und direkt von der Amygdala verarbeitet. „Quick and dirty läuft dieser Prozess ab“, sagt Signe Achterberg. „Zum Nachdenken bleibt bei der instinktiven Angst keine Zeit. Man gerät in einen Teufelskreis der Angst.“ Bei diesem Kreislauf gibt es einen Auslöser, etwa das laute Knacken im dunklen Wald. Dieses Knacken setzt die Gedanken und die Fantasie in Gang, welche Gefahren von diesem Knacken ausgehen könnten. Sitzt vielleicht ein Wildschwein im Gestrüpp des Waldes? Diese Gedanken rufen das Gefühl der Angst hervor. Es folgen die körperlichen Symptome wie kalte Hände, beschleunigter Herzschlag und Schwitzen. Im Folgenden fokussiert sich der verängstigte Mensch auf seine körperlichen Symptome, die wiederum dazu führen, dass die Gedanken weitergehen, was alles hinter dem Knacken stecken könnte. Ist es vielleicht gar kein Wildschwein, sondern ein Säbelzahntiger? Das wiederum verstärkt die Angst, und ihre körperlichen Reaktionen; und es wird zunehmend schwerer, aus dem Kreislauf der Angst auszusteigen.
Angst und Geist
„Deine Angst ist aber kein Hellseher“, sagt Signe Achterberg, und meint damit, dass die körperlichen Signale noch lange kein Beweis für einen Säbelzahntiger im Unterholz sind – auch wenn wir Menschen genau zu dieser Deutung neigen. Doch Säbelzahntiger sind ausgestorben, und die Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens mit ihnen im Wald tendiert somit gegen Null. Der Angst ist das in diesem Moment jedoch egal, denn sie wird nicht vom Verstand kontrolliert. Um aus dem Kreislauf auszubrechen, rät Signe Achterberg dazu, die Atmung bewusst zu beruhigen, um auch den Herzschlag zu normalisieren. So können wir die körperlichen Symptome der Angst reduzieren. Es kann auch helfen, sich mittels des Verstandes die Situation bewusst zu machen, um auf der gedanklichen Ebene abzuwägen, ob wirklich eine Gefahr bestehen könnte. Man sollte sich selbst beruhigen. Auch sich abzulenken, kann funktionieren: „Man kann vielleicht europäische Hauptstädte von Nord nach Süd aufzählen.“
Reale und irreale Ängste
Bei „Realängsten“ besteht tatsächlich eine Gefahr. Feuer zählt zum Beispiel dazu. Und auch die Begegnung mit einem Säbelzahntiger wäre eine echte Gefahr. Im Falle des dunklen Waldes gibt es potentielle Gefahren. So streifen zwar wenige bis keine Säbelzahntiger durch die Lande, aber Wölfe oder Wildschweinrotten können unter Umständen zu einer Gefahr werden. In den meisten Fällen wird hinter dem Knacken aber nur ein Reh oder der Wind stecken. Es handelt sich dann um eine Erwartungsangst: obwohl keine reale Gefahr besteht, treten körperliche Symptome auf. In ihren Angstgruppen begegnet Signe Achterberg den verschiedensten Ängsten. Der eine hat Angst vor Überforderung, sobald er sich mit Papierkram konfrontiert sieht. Die andere fürchtet sich im Bus, weil es dort keine Fluchtmöglichkeit gibt. Der nächste hat Angst vor Schlangen, Spinnen oder dem Hochgehen einer Wendeltreppe. Diese Ängste müssen nicht rational sein. Evolutionsgeschichtlich gesehen kann gerade eine Angst vor Schlangen, das Überleben sichern. Selbst wenn man vor einer Blindschleiche flieht. Die Amygdala reagiert auf die Form der Schlange. Anders ist es bei Waffen. Hier reagiert die Amygdala nicht, obgleich die Gefahr durch eine Schusswaffe zu sterben größer sein kann als durch einen Schlangenbiss; insbesondere im an Giftschlangen eher armen Europa. Die Angst folgt nicht immer rationalen Gründen, sondern meist den Gefühlen.
Angst in Ostdeutschland
Was Europa allgemein an Giftschlangen fehlt, fehlt speziell in Ostdeutschland an Ausländern. Mit lediglich 2,5 Prozent in Thüringen bis zu 2,9 Prozent in Sachsen lag der Ausländeranteil 2014 weit unter dem Bundesdurchschnitt. Wenn aber gerade dort die Bevölkerung Angst vor den Flüchtlingen hat und vor der „Islamisierung des Abendlandes“, dann handelt es sich psychologisch gesehen nicht um reine Angst, sondern um eine Sorge. Die Angst vor einer Islamisierung Dresdens ist eine Mischung aus einer Erwartungsangst und einer Externalisierung. Es wird einerseits etwas Schlimmes erwartet, ohne dass es eine rationale Begründung dafür gibt, ähnlich dem Säbelzahntiger im europäischen Forst. Andererseits gibt es Tendenzen, einen Sündenbock zu suchen – eine Externalisierung –, den man für die eigenen Existenzängste wie Arbeitsplatzverlust oder sozialen Abstieg verantwortlich machen kann. Die sogenannten besorgten Bürger hören ein Knacken im dunklen Wald und erwarten entgegen aller Wahrscheinlichkeit einen Säbelzahntiger, dabei hoppelt dort nur ein Häschen.
Don’t panic! Keine Panik
„Es ist eine bedeutende und allgemein verbreitete Tatsache, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen.“ Das lehrte Douglas Adams in Per Anhalter durch die Galaxis (Kinder der Achtziger werden sich erinnern, Jüngere seien auf die Verfilmung von 2005 verwiesen). Dies trifft auch auf die Ängste der Menschen zu. Wenn Sie das nächste Mal nachts durch den Deerwerthschen Garten laufen: Don’t panic, keine Panik! Ihre Angst ist kein Hellseher. Atmen Sie ruhig und denken Sie nach. Sollten Sie dann zur Erkenntnis gelangen, doch einem Säbelzahntiger gegenüberzustehen, dann laufen Sie. Zumindest Ihr Körper ist bereits darauf vorbereitet.


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz