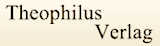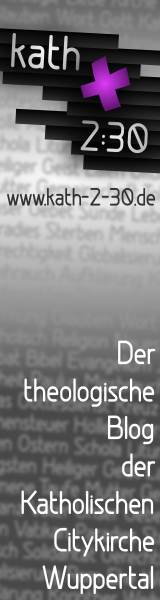Ausgabe 15, September 2015
Phonetisches Schreiben
Eine Debatte zum Prinzip „Schreibe, wie du sprichst“
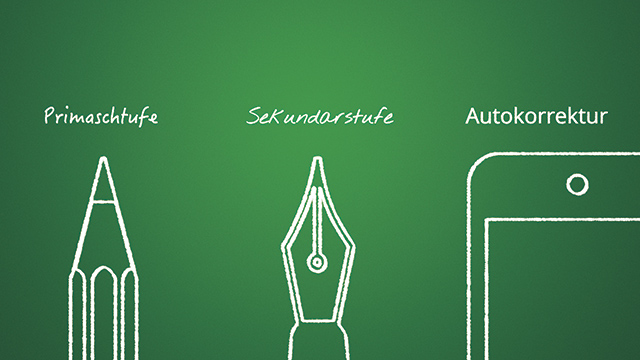
Mit Spaß zum Ernst des Lebens? Wer die Diskussion um die Methoden des Schreibenlernens verfolgt, kommt früher oder später nicht am Spaßargument vorbei. Kinder sollen Spaß am Schreiben haben, sagen die einen. Was aber soll das für ein Spaß sein, wenn das Geschriebene niemand lesen kann, fragen die anderen. Es ist wie bei so vielen Dingen: Am Schreibtisch der Wissenschaft wird ein Ideal entwickelt, das seine Tauglichkeit erst in der gelebten Wirklichkeit erweisen muss. logisch! stellt die Argumente beider Seiten vor.
Sofort lesen und schreiben können – der Traum jedes Kindes
Text Anja Horster, Lehrerin an einer Grundschule
„Endlich lesen und schreiben können“ – das ist der Wunsch jedes Erstklässlers.
Aber was kann so ein Kind eigentlich, wenn es in die Schule kommt? Das eine schreibt seit einigen Wochen seinen Namen, während das andere schon Buchstaben kennt und einzelne Wörter schreibt. Einige Kinder lesen vielleicht sogar schon ein wenig.
Knapp 30 Individuen sitzen dann in einem Klassenraum, jedes mit einem anderen Wissenstand; aber alle haben eins gemeinsam: sie sind motiviert.
Um Kindern einen schnellen Start zu ermöglichen, hat Jürgen Reichen das Konzept „Lesen durch Schreiben“ entwickelt. Hauptarbeitsmittel ist dabei eine sogenannte Anlauttabelle, in der neben jedem Buchstaben ein Bild mit gleichem Anfangsbuchstaben steht:„A wie Affe“, „M wie Maus“, „S wie Sonne“...
Und mit Hilfe dieser Tabelle kann tatsächlich jedes Kind individuell lesen und schreiben lernen. Dabei ist auch die innere Motivation der Schüler und Schülerinnen Antrieb, sich immer neue Worte anzueignen.
„Aber früher haben wir es doch auch gelernt“, rufen nun die Kritiker. Ja, das haben wir. Allerdings, indem wir wochenlang nur „mu, mo, ma, fu, fo, fa, lu, lo, la“ geschrieben haben. Erst deutlich später kamen bei dem Fibellehrgang Wörter dazu. Motivation? Null! Das Gefühl, ein starkes, kluges Grundschulkind zu sein? Nicht wirklich!
Die Rechtschreibung ist wahrscheinlich der meist diskutierte Aspekt in Reichens Konzept. Denn wer so schreibt wie er hört, der macht auch Fehler. Aber ist das ein Problem? Ist es nicht vielmehr wichtig, sich der Sprache und ihrem Aufbau im Laufe der Zeit bewusst zu werden, um die Rechtschreibregeln auch tatsächlich zu verstehen, anstatt sie nur auswendig zu lernen?
Es bedarf sicherlich einer überlegten Hinführung zu korrekter Rechtschreibung, bei der anfangs so wenig wie möglich, und im Laufe der Zeit immer mehr auf die richtige Schreibweise geachtet wird. Aus meiner Sicht ist eine intensive Arbeit mit der Anlauttabelle genauso wichtig wie der gezielte Einsatz geeigneter Schreibanlässe. Denn ein Kind, das sofort alle Buchstaben kennen lernt, erschließt sich bemerkenswert schnell auch Wörter aus der Umgebung. Und plötzlich liest das Kind die Werbung auf Plakaten, die Zeitungsüberschriften, schreibt schon nach wenigen Wochen kleine Briefchen und erzählt jedem stolz, dass es jetzt schon lesen und schreiben kann.
Schwieriger ist es bei Kindern mit einer Legasthenie oder mit sprachlichen Defiziten. Allerdings denke ich, dass jedes Konzept – so gut es für die meisten Kinder ist – eben auch seine Grenzen hat. Dann gilt es als Lehrerin eine sinnvolle individuelle Lösung zu finden, um auch diesen Kindern eine motivierende Form des Schriftspracherwerbs zu ermöglichen.
Denn eines ist wohl unumstritten: Rechtschreibung kann man lernen, aber ein gutes Selbstbewusstsein und innere Motivation sind die Grundlage jeden Lernens.
„Di Schulä wa mal wieda richtik schwea hoite“
Text Sebastian A. Schulz
Es ist eine wahre Freude, wenn Kinder im ersten Schuljahr den Bezug zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort herstellen. Die ersten Schreibversuche sind natürlich noch keine rechtschreiblichen Meisterwerke. Jedoch zeigen sie den Eintritt in eine Laufbahn des jahrelangen Umgangs mit der eigenen Sprache sowie mindestens ein bis zwei fremden Sprachen.
Bald trifft man jedoch auf Kinder aus der zweiten und dritten Klasse, die kaum in der Lage sind, einen kurz zuvor gehörten Satz in ein später vorausgesetztes Maß an ordentlicher Rechtschreibung umzusetzen.
„Di Schulä wa mal wieda richtik schwea hoite“. Der erste Blick schweift noch über dieses Meisterwerk des interessanten und flexiblen Umgangs mit der eigenen Sprache. Bei einem zweiten Blick auf den verfassten Wortlaut und den noch jungen Verfasser oder die junge Verfasserin ist ein Stirnrunzeln nicht mehr zu vermeiden.
Was hier beschrieben wird, ist keineswegs ein Beispiel eines selektiven Einzelfalls, sondern vielmehr eine Vorgabe im Unterricht der ersten Grundschuljahre. Die „phonetische Schreibung“ oder das Prinzip „Schreibe, wie du sprichst“ sind pädagogische Auswüchse, welche in fachdidaktischen Hinweisen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen nachzulesen sind. Im Grunde sollen die Schüler das gehörte Wort nach einem Raster gelernter Buchstaben und Klänge zuordnen und sie dann zu Papier bringen. Die Ergebnisse sind Sammlungen von Sätzen, die mit einer Rechtschreibung wenig gemein haben, die im künftigen Schulweg vorausgesetzt wird. Und schließlich folgt die Krönung: der Wendepunkt. Spätestens in der dritten Klasse sollen dann Lehrer ihren Schülern diese Art der verbalen Umsetzung wieder „austreiben“.
Legt man den unter Umständen sozial ausgelegten Ansatz einer vereinfachten Sprachausbildung zu Grunde – vor allem bei zweisprachig aufgewachsenen Kindern – kann man den jeweiligen Pädagogen zumindest einen Sinn für Gleichberechtigung zusprechen. Die erfolgreiche Korrektur fehlender Rechtschreibung ist jedoch von der erfolgreichen Umsetzung durch die Lehrer abhängig. Inzwischen setzt das Bildungsministerium wieder auf eine „Relativierung der Strategie ‚Schreibe wie du sprichst‘“. Die Jahrgänge vor diesem moderaten Kurswechsel müssen sich jedoch als Teil eines fehlerhaften pädagogischen Experiments sehen. Aus meinen Beobachtungen im persönlichen Umfeld und aus Gesprächen mit Lehrern kann ich schließen, dass es anfangs bei einer Fremdsprache nicht einfach ist, fremde Schreibweisen zu verstehen, wenn die eigene nicht gefestigt ist.
Ein Fazit könnte sein, dass pädagogische Experimente nötig sind, um Reformen im Schulwesen zu erwirken. Andererseits zeigen entstandene Kollateralschäden, dass die Allianz aus forschenden Pädagogen und Politik nicht immer mit den praktizierenden Pädagogen übereinstimmt. Doch um fair zu bleiben: Wär one Sündä ist, wärfe den ersten Stain.


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz